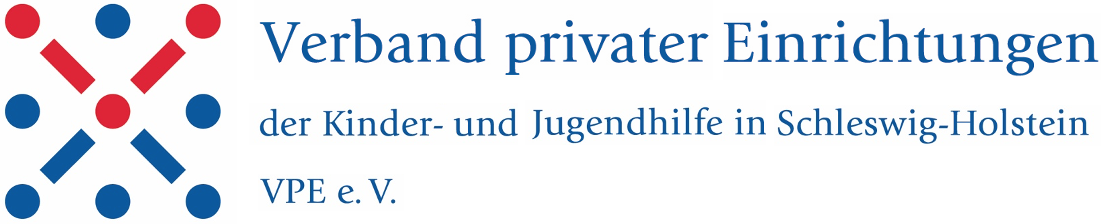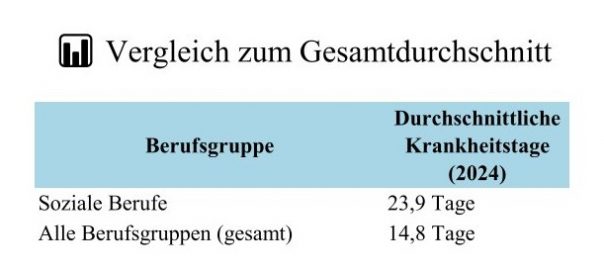Was ist die „Große Lösung“ – kurz aus unserer Sicht?
Ab 1. Januar 2028 sollen Jugendämter für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen zuständig sein – unabhängig von der Art der Behinderung. Für private Einrichtungen bedeutet das:
• ein einheitlicher Verhandlungspartner (Jugendämter statt paralleler Systeme)
• einheitliche Qualitäts- und Leistungsanforderungen
• einheitliche Entgelt- und Vertragsstrukturen
• einheitliche Bedarfsermittlung und Hilfeplanung
• neue Angebotsformen, die körperliche, geistige und seelische Behinderungen einschließen
Die Große Lösung ist also nicht nur eine Verwaltungsreform – sie greift viel tiefer, weil sie unmittelbar die Angebote der Jugendhilfe beeinflusst: Sie ist eine Markt- und Strukturreform.
Die Inklusive Lösung wird oft aus kommunaler Perspektive diskutiert: Zuständigkeiten, Verwaltungsstrukturen, Fallzahlen, Personalbedarf. Doch für die (privaten) Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist diese Reform mindestens genauso bedeutsam – und zwar nicht erst 2028, sondern jetzt, da sich viele Fragen um den Prozess herum stellen.
Die Kommunen haben ihre eigene, gut vernetzte Lobby, die Interessen der freien, insbesondere privaten Träger, sind in der Debatte bislang unterrepräsentiert. Dabei wird die Große Lösung die Angebotslandschaft, die Vertragsstrukturen und die fachlichen Anforderungen massiv verändern.
Was ist also zu welchem Zeitpunkt im Prozess der „Großen Lösung“ in Schleswig-Holstein geschehen?
Kurz gesagt: In Schleswig-Holstein gibt es bislang keine eigenen politischen Anpassungen oder Landesgesetze, die die „Große Lösung“ (Inklusive Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII) konkret ausgestalten würden. Die Landespolitik verweist – wie andere Länder auch – darauf, dass die Bundesregelungen noch ausstehen und erst das kommende Bundesgesetz (geplant zum 1.1.2027) den verbindlichen Rahmen setzt. Innerhalb eines Jahres sollen also sämtliche Veränderungsprozesse angestoßen und umgesetzt werden bis zu ihrer Einführung.
• Die inklusive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe wurde mit dem KJSG 2021 eingeleitet.
• Die vollständige Zusammenführung der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen – mit und ohne Behinderung – soll zum 1.1.2027 in Kraft treten.
• Dafür ist ein weiteres Bundesgesetz erforderlich, das die Details regelt. Dieses Gesetz liegt noch nicht vor.
• Das Land Schleswig-Holstein kann daher keine abschließenden landesrechtlichen Anpassungen vornehmen, bevor der Bund den Rahmen festlegt.
Schleswig-Holstein beschränkt sich bislang auf fachliche Vorbereitung, ohne jedoch die notwendigen politischen Strukturentscheidungen zu treffen:
Zwar hat das Land Orientierungshilfen – etwa zur Rolle der Verfahrenslots*innen – veröffentlicht, doch diese ersetzen keine verbindlichen Beschlüsse zur organisatorischen oder finanziellen Umsetzung der Großen Lösung. Parallel beteiligt sich das Land zwar an bundesweiten Arbeitsgruppen wie der BAG Landesjugendämter, wo Empfehlungen erarbeitet werden, doch entstehen dort keine landesspezifischen Regelungen, die den Kommunen oder Trägern echte Planungssicherheit geben würden. Besonders deutlich wird die Zurückhaltung im Landesrecht: Weder das Landesjugendhilfegesetz noch andere Ausführungsgesetze wurden bislang angepasst; es gibt keine Entscheidungen zur zukünftigen Zuständigkeitsverteilung, keine Finanzierungs- oder Übergangsregelungen und keine Vorgaben zur inklusiven Infrastruktur. Gleichzeitig ist absehbar, dass Schleswig-Holstein all diese Themen bearbeiten muss, sobald der Bund das erwartete Gesetz zur Großen Lösung vorlegt – denn ohne landespolitische Rahmensetzung wird die Umsetzung im Jahr 2028 kaum gelingen.
Dabei zeigen andere Bundesländer, wie aktiv sich die Vorbereitungen zur Umsetzung ausführen lassen: Sie setzen Standards, mit u.a. umfassender Landesstrategie (Rheinland-Pfalz), Handbuch für Jugendämter (Hessen), Fachstellen zur Unterstützung bei der Umsetzung (Brandenburg) u. ä. Gerade veröffentlicht wurde hierzu eine Roadmap, die das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer im Auftrag und mit Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des Projekts „Umsetzungsbegleitung KJSG: Umstellung der Verwaltungsstrukturen im Bereich der Eingliederungshilfe“ (2022–2025) erarbeitet hat.
Wo verdichten sich die zentralen Konfliktlinien der Reform in der Umsetzung?
Im politischen und fachlichen Ringen um die Große Lösung zeigt sich ein Spannungsfeld, das weit über Verwaltungsfragen hinausgeht: Kommunen, die künftig alle Leistungen verantworten sollen, drängen auf maximale Steuerungshoheit und Kostenkontrolle – oft mit der Tendenz, die Angebotslandschaft stärker zu kommunalisieren. Das Land wiederum verharrt in einer abwartenden Haltung und scheut klare Vorgaben, solange das Bundesgesetz nicht vorliegt, was zu fehlenden Standards und mangelnder Orientierung führt. Die Eingliederungshilfe versucht, ihren fachlichen Einfluss zu sichern, weil sie mit der Reform zentrale Zuständigkeiten verliert und befürchtet, dass komplexe Bedarfe im Jugendhilfesystem untergehen könnten. Freie und insbesondere private Träger stehen damit zwischen allen Stühlen: Sie brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, faire Entgelt- und Qualitätsstandards, Übergangsfristen und eine klare Rolle in der zukünftigen Angebotsstruktur. Genau hier liegen die entscheidenden Schnittmengen für uns als Berufsverband: Wir müssen verhindern, dass kommunale Steuerungsinteressen oder landespolitisches Zögern zu Lasten der Trägervielfalt gehen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass die fachliche Expertise der Eingliederungshilfe nicht verloren geht, sondern in die Jugendhilfe integriert wird. Die Große Lösung ist damit nicht nur eine Reform der Zuständigkeiten – sie ist ein Aushandlungsprozess zwischen vier Machtzentren, in dem wir die Stimme der privaten Einrichtungen stark und hörbar platzieren müssen.
Die Reform zur „Großen Lösung“ wird nicht automatisch inklusiv, gerecht oder fachlich sinnvoll. Sie wird so, wie die Akteure sie gestalten.
Kommunen wollen steuern.
Das Land will abwarten.
Die EGH will Einfluss behalten.
Freie Träger wollen Vielfalt sichern.