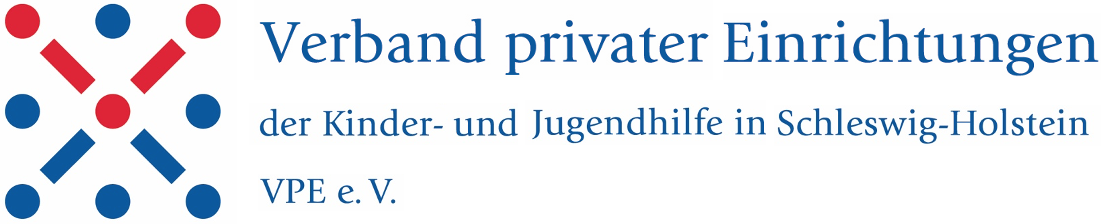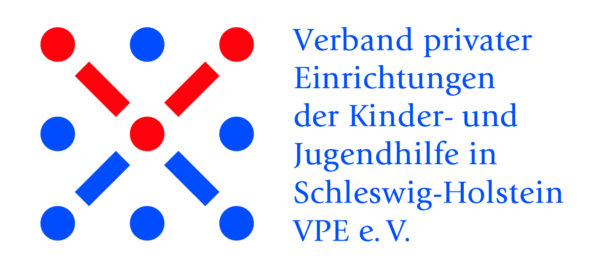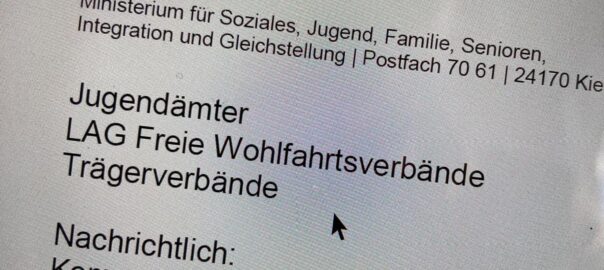Gestern fand in den Räumlichkeiten des CoWork ein Workshop zur Erarbeitung und Standortbestimmung der jeweiligen Einrichtungen für ihr individuelles Schutzkonzept statt.
Neben der Vorgabe durch das 2021 in Kraft getretene KJSG ging es vor allem um Erfahrungen, die bisher gemacht wurden, in denen das bisherige Schutzkonzept hilfreich war. Definierte Abläufe, Kontaktaufnahmen und Präventionsmaßnahmen zu den Themenbereichen Kinder / Jugendliche, Familienkonstellationen, sowie auf der Fachkräfteebene waren Inhalte des Fortbildungstages.
Als Ergebnis lässt sich eine Mustergliederung für ein Schutzkonzept sehen, sowie für die jeweiligen Einrichtung eine Auswertung der Bestandsaufnahme mit dem Wissen, welche Bestandteile für sie von hervorgehobener Bedeutung sind.
Durch Fluktuationen in Belegung durch (neue) Kinder und Jugendliche, durch neue Mitarbeiter*innen entstehen immer wieder neue und andere Themen, sodass sich der Schwerpunkt innerhalb des Schutzkonzeptes stetig ändert.
Diesem Aspekt Rechnung getragen, befassen wir uns jährlich mit dem Thema Schutzkonzept und bieten als Verband diese Fortbildung als Leistung für unsere Mitglieder an.