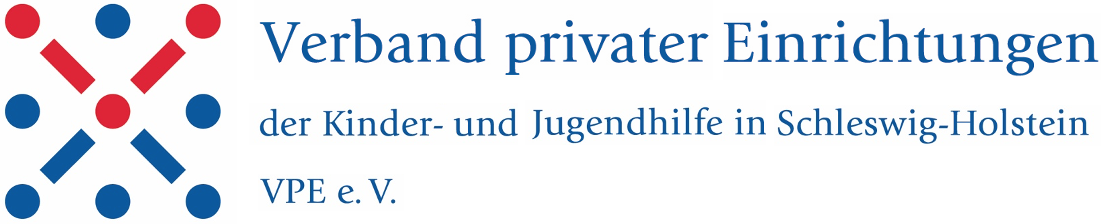Die private Kinder und Jugendhilfe – Lebenschancen entwickeln und gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen
Die privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe leisten einen wichtigen Beitrag um Schicksale junger Menschen zum Positiven zu verändern. Unser Einsatz ist daher von besonderem Wert für das Individuum und insbesondere für die Gesellschaft, da dieser sie vor zukünftigen Lasten bewahrt.
Unser Verband setzt sich dafür ein, auf politischer Ebene und in der Gesellschaft ein Bewusstsein und Verständnis für unsere wichtige Arbeit zu erzeugen. Wir stehen mit ganzer Kraft hinter unseren Mitgliedern und sehen uns dabei nicht als Vertreter monetärer Interessen sondern richten unser Engagement anhand von ethisch normierten Qualitätsansprüchen aus.
Unser ethischer Verantwortungsbereich umfasst darüber hinaus unsere Mitarbeiter*innen wie auch uns selbst, den Träger*innen der Einrichtungen.
Wir nehmen durch unser Tun gesellschaftliche Verantwortung wahr und fühlen uns dieser verpflichtet.
Stellungnahmen
Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft der privaten Jugendhilfeverbände (Lag-pJ)
Betreff: Neuverhandlung eines Jugendhilferahmenvertrags sowie Rolle der Kosoz in Schleswig-Holstein
3. Juni 2025
Als Landesarbeitsgemeinschaft in Schleswig-Holstein vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder, private freie Träger, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Kinder- und Jugendhilfe im Land leisten. Mit großer Sorge beobachten wir, dass ein neuer Rahmenvertrag nach § 78f SGB VIII verhandelt wird – aktuell ohne Einbeziehen der privaten freien Träger.
Zudem plant die Kosoz das Vertragsmanagement im SGB VIII zu übernehmen – dies ist für unsere Mitglieder problematisch, sollte dies in Anlehnung an bestehende Strukturen des SGB IX geschehen.
Beide Entwicklungen sind aus unserer Sicht hoch problematisch und bedürfen einer kritischen öffentlichen Debatte.
Nachfolgend möchten wir dies näher spezifizieren:
1. Der Grundsatz der Trägerpluralität ist rechtlich verbindlich
Nach § 4 SGB VIII gilt der Grundsatz der Trägerpluralität. Dieser verpflichtet die öffentlichen Träger der Jugendhilfe, bei der Planung und Durchführung von Angeboten eine Vielfalt freier Träger unterschiedlicher weltanschaulicher, religiöser oder konzeptioneller Ausrichtung zu berücksichtigen und aktiv einzubeziehen. Die Trägerpluralität ist keine optionale Leitlinie, sondern ein gesetzlicher Auftrag, der die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern absichert.
Ein Rahmenvertrag nach § 78f SGB VIII ist ein zentrales Steuerungsinstrument der Jugendhilfe – er betrifft alle Leistungserbringer gleichermaßen. Eine Ausarbeitung ohne die Mitwirkung privater Träger stellt eine Missachtung dieses gesetzlichen Grundprinzips dar und gefährdet die Vielfalt und Passgenauigkeit der Hilfeangebote.
Wir stellen jedoch mit Besorgnis fest, dass die aktuellen Verhandlungen zur Rahmenvertragsverhandlung unter Ausschluss privater Träger erfolgen. Dies widerspricht dem gesetzlich verankerten Grundsatz der Trägerpluralität nach § 4 SGB VIII.
Ein Rahmenvertrag betrifft alle Leistungserbringer – öffentlich, freigemeinnützig oder privatwirtschaftlich organisiert. Private Träger sind integraler Bestandteil der Jugendhilfelandschaft in Schleswig-Holstein. Auch diese leisten qualifizierte, engagierte und bedarfsgerechte Arbeit – insbesondere in kleineren, flexiblen Strukturen, die für viele junge Menschen besonders förderlich sind.
Daraus ableitend müssen auch alle Leistungserbringer gleichberechtigt in die Verhandlungen eingebunden werden.
Es wurde zurückliegend vorgeschlagen, dass die privaten Träger dem Rahmenvertrag nach Abschluss der Verhandlungen beitreten könnten – ohne zuvor direkt oder indirekt an den Verhandlungen beteiligt worden zu sein.
Ein solcher Vorschlag ist aus unserer Sicht nicht zielführend:
Ein Rahmenvertrag, der ohne Mitwirkung eines Teils der Trägerlandschaft verhandelt wurde, kann nicht als legitim und verbindlich für alle – insbesondere für die Nichtteilnehmer an den Verhandlungen – gelten.
Die nachträgliche Beitrittsoption ersetzt keine gleichberechtigte Mitgestaltung und widerspricht dem Grundprinzip der partnerschaftlichen Ausgestaltung sozialer Leistungen nach dem SGB VIII.
2. Rolle der Kooperationsgemeinschaft für soziale Aufgaben, AöR (Kosoz)
Die Kosoz hat sich im Rahmen eines Modellprojekts in einzelnen Regionen Schleswig-Holsteins an der Verhandlungsführung im Auftrag von Jugendämtern beteiligt bzw. diese federführend übernommen.
In einem Schreiben an die Landräte, Kreistagspräsident/innen und Fraktionsvorsitzenden der Kreistage des Landes wurde nun eine erste Auswertung dieses Projekts vorgelegt (vom 31.03.2025), verbunden mit der impliziten Absicht, das Vertragsmanagement künftig dauerhaft zentralisiert über die AöR abzuwickeln, analog zum Modell aus dem SGB IX (Eingliederungshilfe).
Wir halten diese pauschale Gleichstellung für nicht zielführend und unvollständig, da:
- die vorgelegte Auswertung lediglich auf einer sehr kleinen Stichprobe mit begrenztem regionalem und strukturellem Umfang basiert
- die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen methodisch nicht tragfähig sind und repräsentieren keinesfalls die komplexe Vielfalt der Jugendhilfelandschaft in Schleswig-Holstein
- eine Vergleichbarkeit der Einrichtungen kann nur bedingt gegeben sein, da viele Faktoren diese beeinflussen (Auszug):
- konzeptionelle Ausrichtung (Einrichtungsgröße, Konzeption, Auftragsumfang… jeder Träger ist anders und erhält differenzierte / bundesweite „Aufträge“ für die Betreuten)
- differenzierte Zielgruppen (Alter, Geschlecht, biografische Besonderheiten…),
- individuelle Schwerpunkte in / um den Leistungsbereich (familienorientiert, geschlechterspezifisch, intensivpädagogisch…)
- Individuelle Leistungen (Therapieangebote etc.),
Eine pauschale Übertragung – der vorliegenden Projektauswertung – auf alle Jugendhilfeeinrichtungen in Schleswig-Holstein (von 2-3 Plätzen an … / Aufnahmealter 0+ Jahre…) ist aus unserer Sicht nicht haltbar und führt zu verkürzten, unangemessenen Verallgemeinerungen, welche weder den erhaltenen Aufträgen von Seiten der Entsendestellen noch den Bedarfen der Beureuten individuell gerecht werden bzw. diese beeinträchtigen können.
3. Gefährdung der Trägerpluralität
Die vorgesehene Rolle eines Vertragsmanagements mit der Kosoz als Vertragsinstanz ist kritisch zu sehen:
Die optionale Übertragung des Vertrags- und Verhandlungsmanagements auf die Kosoz, ist aus Sicht der Jugendhilfe nicht sachgerecht.
Die Kinder- und Jugendhilfe folgt anderen fachlichen und strukturellen Prinzipien als die Eingliederungshilfe.
Durch erste Erfahrungen unsererseits in Verhandlungen mit der Kosoz ist anzunehmen, dass die Planung seitens der Kosoz vorsieht, Verhandlungen mittelfristig ähnlich der Struktur im SGB IX (Eingliederungshilfe) zu führen. Eine zentralisierte und standardisierte Verwaltung über die Kosoz steht im Widerspruch zu den Anforderungen des SGB VIII, das auf Dialog, regionale Vernetzung und partizipative Ausgestaltung der Hilfen setzt.
Eine solche Struktur kann zu einer Verstaatlichung von Verhandlungs- und Angebotsvielfalt führen, wodurch die freie Trägerlandschaft – insbesondere kleinere, spezialisierte und private Einrichtungen – strukturell benachteiligt oder sogar verdrängt würden.
Unsere Forderung:
- fachlich begründetes Veto an eine allgemeingültige Vereinheitlichung / Standardisierung des Vertragsmanagements über eine AöR, wenn dadurch die gesetzlich garantierte Trägerpluralität eingeschränkt wird
- Respekt vor der gesetzlichen Struktur des SGB VIII, das auf partnerschaftliche Kooperation und Vielfalt setzt – nicht auf Monostrukturen
- eine offene, transparente und partizipative Verhandlungsstruktur, an der alle maßgeblichen Trägergruppen beteiligt sind – einschließlich der privaten Träger
- die Anerkennung der Vielfalt der Trägerlandschaft als Stärke des Jugendhilfesystems
- eine zielführende sowie konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe zur Entwicklung eines tragfähigen, fairen und rechtskonformen Rahmenvertrags, der den Bedürfnissen der jungen Menschen gerecht wird.
Wir fordern alle Beteiligten – insbesondere das Land Schleswig-Holstein und die Kommunalen Spitzenverbände – dazu auf, diese zentralen Grundsätze der Jugendhilfe zu wahren und mit uns gemeinsam und kooperativ an einem pluralen, fachlich fundierten und gerechten Jugendhilferahmenvertrag zu arbeiten.
Wir stehen als Landesarbeitsgemeinschaft der privaten Jugendhilfeverbände für einen offenen und konstruktiven Dialog bereit.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Daum
1. Vorsitzende
Stellungnahme herunterladen
Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft privater Jugendhilfeverbände e.V. herunterladen
Stellungnahme zum Zeitungsartikel der KN vom 19.07.2022 durch Sozialministerin Aminata Touré zur Beschulung von Heimkindern
1. Dezember 2022
Bezug nehmend auf den o. a. Zeitungsartikel der Sozialministerin möchten wir ausdrücklich Stellung beziehen, da dieser zum einen aus unserer Perspektive jeglicher Grundlage entbehrt, zum anderen nachhaltig für Unmut unter unseren Mitgliedseinrichtungen gesorgt hat.
Die Darstellung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, die lediglich auf Profit ausgerichtet sind, aus diesem Grund die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen intern beschulen, und damit einhergehend das Wohl der jungen Menschen nicht als oberste Maßgabe priorisieren, ist nicht korrekt.
In § 20 des schleswig-holsteinischen SchulG ist geregelt, dass Kinder und Jugendliche, deren melderechtliche Hauptwohnung nicht in Schleswig-Holstein ist, die Schulen in Schleswig-Holstein besuchen können.
Dieser Passus aus § 20 SchulG wird von Seiten der Träger schon länger kontrovers diskutiert. Aus Sicht der Pädagog*innen der stationären Erziehungshilfe und der betreuten Kinder und Jugendlichen ist, unter Berücksichtigung der enormen Wichtigkeit schulischer Bildung im Kontext der Verselbständigungsarbeit in den Einrichtungen, eine definierte Schulpflicht in Schleswig-Holstein, ohne Berücksichtigung der melderechtlichen Hauptwohnung, deutlicher Wunsch und Gleichstellungsmerkmal.
In der Praxis ist es keineswegs so, dass dieses bedeutet, dass Kinder und Jugendliche, die aus anderen Bundesländern kommen, die Wahl haben nicht beschult zu werden. Viel mehr ist es so, dass ein sofortiger Eintritt in eine Regelschule auch bei bestehender Schulpflicht nicht der Regelfall ist. Häufig haben insbesondere massive Verhaltensauffälligkeiten und besondere Bedarfe im schulischen Bereich in der Historie des Kindes die Aufnahme in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung begründet, da die Kinder und Jugendlichen mit ihren Auffälligkeiten im Schulalltag oft nicht tragbar sind.
Mit Hilfe der Lerneinrichtungen vor Ort der Einrichtungen werden Strukturen geschaffen und erlernt, mit denen die Kinder und Jugendlichen ein Lernen im „Alltag Schule“ ermöglichen. Dazu gehören u. a. der Abbau von Schulangst, Resignation und / oder Isolation, Steigerung von Sozialkompetenz, aber auch das Erlernen von Disziplin, Ausdauer, als auch Körperbeherrschung, sowie in Teilen auch die fachliche Steigerung in Kernfächern, die ein soziales Miteinander in einer Regelschule und eine Beschulung im öffentlichen Schulsystem erst wieder ermöglichen.
Der in dem Zeitungsartikel entstandene Eindruck, dass die Träger von Jugendhilfeeinrichtungen ein monetäres Interesse daran haben Kinder und Jugendliche nicht in regulären Schulen zu integrieren, möchten wir entschieden zurückweisen.
Gemäß einer formulierten Schulpflicht für alle Kinder, ob in Schleswig-Holstein gemeldet oder nicht, gilt es dann für alle Seiten verbindliche Rahmenbedingungen für die schulische (Re-) Integration zu schaffen. Dieses ist immer ein wichtiges Ziel in Verbindung damit, bei den Schüler*innen die individuellen Bedarfe zu berücksichtigen.
Für Schüler*innen mit besonderen Herausforderungen in ihrer Biografie ist es aus unserer Sicht wichtig einen gleichberechtigten Zugang zu den öffentlichen Bildungsangeboten zu erhalten. Dennoch ist es für ein Gelingen oft notwendig, dass individuelle Wege und das Erlernen von alternativen Bewältigungsstrategien in den Lernangeboten der Einrichtungen erarbeitet und gefestigt werden können.
Wenn gleich auf Seiten der Gleichstellungsbeauftragten und der Sozialministerin der Eindruck entstanden ist, dass die Formulierungen des § 20 SchulG zu Kindern und Jugendlichen mit melderechtlicher Hauptwohnung außerhalb Schleswig-Holsteins der Nachbesserung bedürften zur Gleichbehandlung und im Interesse aller Betreuten in den Erziehungshilfeeinrichtungen, so unterstützen wir dieses ausdrücklich.
Um sich einen persönlichen und umfassenden Eindruck zu verschaffen, sind Sie jederzeit zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.

Stellungnahme herunterladen
Unsere Stellungnahme an das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung
Auslegung von § 28b IfSG
27. Dezember 2021
In vorbezeichneter Angelegenheit ist bei einigen unserer Mitgliedsunternehmen die Frage aufgekommen, wie § 28b IfSG n.F. auszulegen ist. Es herrscht hier insbesondere Unsicherheit im Hinblick auf die Frage, ob Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen unter den Einrichtungsbegriff des § 28b Abs. 2 IfSG fallen und demzufolge weitergehenden Maßnahmen unterworfen sind als Unternehmen, auf die lediglich § 28b Abs. 1 IfSG anzuwenden ist.
Es dürfte zunächst Einigkeit dahingehend bestehen, dass gewöhnliche Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen generell keine Einrichtungen im Sinne von § 28b Abs. 2 i.V.m. § 23 Abs. 3 S. 1 oder i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 IfSG darstellen. Nicht ganz eindeutig ist die Einordnung jedoch dann, wenn eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung auch Leistungen nach § 35a SGB VIII erbringt. Denn gemäß § 28b Abs. 2 i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 IfSG fallen in den Anwendungsbereich des § 28b Abs. 2 IfSG u.a. auch voll- und teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung behinderter oder pflegebedürftiger Menschen. Da in § 35a SGB VIII die Rede von Leistungen für Kindern und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung ist, dürften Einrichtungen, die derartige Leistungen erbringen, dem Wortlaut des § 36 Abs. 1 Nr. 2 IfSG folgend unter § 28b Abs. 2 fallen.
Dies hätte zur Folge, dass Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, die auch nur ein Kind auf der Grundlage des § 35a SGB VIII betreuen, die weitergehenden Pflichten nach § 28b Abs. 2 IfSG zu erfüllen hätten (u.a. Testkonzept für Mitarbeiter und Besucher, Informationspflichten gegenüber der zuständigen Behörde etc.).
Um hier eine rechtlich verbindliche Einschätzung für unsere Mitgliedsunternehmen zu bekommen, bitten wir darum, uns die nachstehenden Fragen sehr zeitnah zu beantworten:
1. Ist die oben genannte Rechtsansicht zutreffend, wonach Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen generell lediglich dem Anwendungsbereich des § 28b Abs. 1 IfSG unterfallen?
2. Ändert sich an dieser Einschätzung etwas, wenn die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Leistungen nach § 35a SGB VIII erbringt? Kommt es bei der Beurteilung dieser Frage darauf an, ob eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII für derartige Leistungen vorhanden ist?

Stellungnahme herunterladen
Unsere Stellungnahme an das Landesjugendamt (VIII 307 Einrichtungsaufsicht und Trägerberatung)